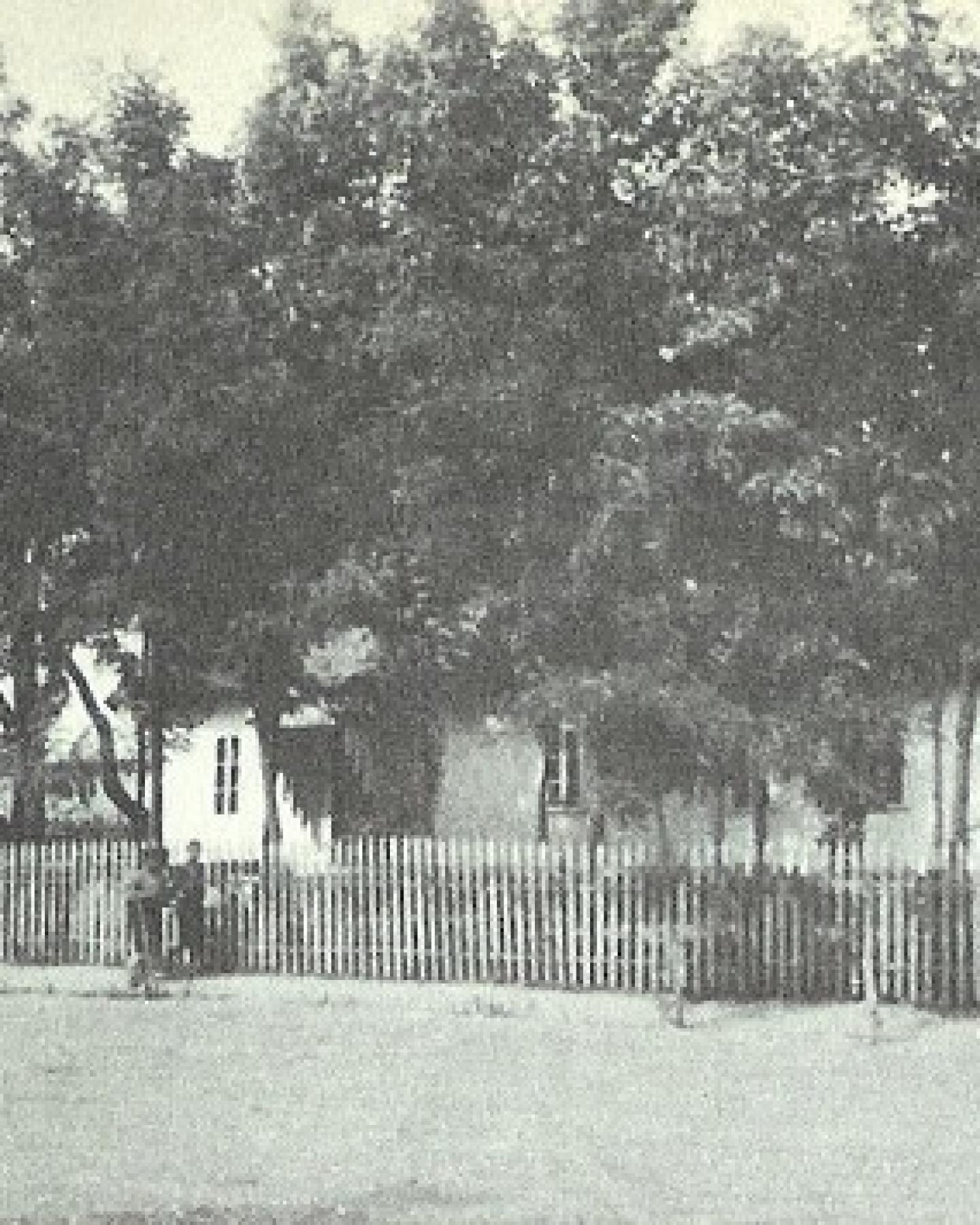Landmenge (Hektar) – bei Gründung/bei Umsiedlung
Bet- und Schulhaus Hirtenheim
Lokalisierung
Moladawien wischen den Städten Bender und Kischinew.
Gründerfamilien
Martin Kruckenberg (Arzis), Gottlieb Merz I und II (Beresina), Jakob und Johann Renk (Kulm), Joh. Beierle (Picitzk), Chr. Werner (Leipzig), Friedrich und Joh, Albrecht (Friederistal).
Einwohner
Volkszählung 1930: 328 Deutsche / 472 Andere
Einwohner 1940: 342 Deutsche /
Karte
Historie
„Das kleine Hirtenheim zumal" (Solo) liegt abseits und verborgen wie sein Schul- und Bethaus im Grün der Akazienbäume und umgeben von einem abgrenzenden, schützenden Zaun. Das idyllische Bild erinnert an Psalm 23; „Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln". Nach einem Bericht aus dem Jahre 1904 zählte die Pachtgemeinde Ciobana (aus dem Rumänischen: Hirte) 274 Seelen, darunter 65 Schüler. Ein Schulsaal diente zugleich als Betsaal.
25 Kilometer westlich von Bender ließen sich 1887 Deutsche, auf „Wanderschaft" befindliche Pächter, hier, in einer verwilderten und verwahrlosten Steppe nieder. Sie gehörte dem Baron Stuart – wird wohl mit dem schottischen Königshause der Maria Stuart nichts zu tun haben –, doch war ja Bessarabien das Land der geadelten und in Ungnade gefallenen Prominenz aus allen Völkern, die an den, Zarenhöfen als Günstlinge lebten. Aber die Steppe, der diese Herren kaum einen würdigenden Blick schenkten, kam bald unter die Pflugschar tüchtiger deutscher Bauern, die sie liebgewannen; so auch in Hirtenheim.
Das Land wurde im ersten Pachtvertrag auf zwölf, im zweiten auf zehn und im dritten auf acht Jahre gepachtet. Das Land war so verwahrlost, dass die Zeit des ersten Pachtvertrages nicht so viel einbrachte, um an den Kauf des Landes zu denken, auch waren die Gründer nicht so reich wie anderwärts. Sie hießen: Martin Kruckenberg (Arzis), Gottlieb Merz I und II (Beresina), Jakob und Johann Renk (Kulm), Joh. Beierle (Picitzk), Chr. Werner (Leipzig), Friedrich und Joh, Albrecht (Friederistal). Die Hirtenheimer waren fleißige, sparsame und ordentliche Bauersleute. Die Erträge der Arbeit waren auskömmlich bis gut. Durch die günstige Lage zwischen den Städten Bender und Kischinew und durch die Nähe der Bahnstation war der Absatz der Erzeugnisse gut. Hier ging es den Pächtern besser als in der Enge der Heimatgemeinden. Es fehlte nur das Kapital, um das Land zu kaufen. Leider, vorsichtig ausgedrückt, fehlte bei vielen Pachtgemeinden ein kleiner Schuss von Landhunger, um mit dem Kauf nicht zu spät zu beginnen. Als der letzte Pachtvertrag abgelaufen war, befand sich die Welt mitten im Ersten Weltkrieg.
Das echt deutsche Dorf hatte zwei Reihen großer Bauernhäuser, die mit einer Mauer oder einem Zaun zur Straße abgegrenzt waren. Eine prächtige Akazienallee zierte die Gehwege.
Die Gemeinde nahm sichtbar an Wohlstand zu. Sie errichtete einen Gemeindeladen und eine Molkerei. Die Pferde-, Hornvieh- und Schafzucht wurde dem letzten Stand der vom Staate gegebenen Richtlinien angepasst.
Da kam die Revolution von 1917 mit ihren Nöten und Ängsten für die abseits gelegenen deutschen Gemeinden. Nach dem Krieg enteignete die rumänische Regierung das Land, und die Hirtenheimer erhielten gegen Bezahlung an den Staat je 6 Hektar des von ihnen mit saurem Schweiß kultivierten Landes. Dreißig Jahre hatten sie somit auch für andere gearbeitet, die mit denselben Rechten ausgestattet, eines Tages als Nachbarn auf einem urbar gemachten Acker standen.
Kirchlich gehörte Hirtenheim bis zur Umsiedlung zum Kirchspiel Kischinew. Schon 1890 wurde das Schul- und Bethaus erbaut. Nachdem nach der Agrarreform am Rande ein moldauisches Dorf angelegt wurde, baute die Gemeinde das Bet- und Schulhaus um, so dass der Schulsaal abgetrennt wurde. Auch erstellte die Gemeinde ein Gebäude für die Verwaltung. Da kam 1940 der Abschied von Hirtenheim.
Nach der Kartei festgestellte Verluste unter den Zivilpersonen (Stand vorn 31. Deumber 1964)
Verschleppte: 2
Auf der Flucht und in der Verschleppung Verstorbene: 1
Quelle: Heimatbuch der Bessarabiendeutschen, Pastor Albert Kern, S. 249 f.